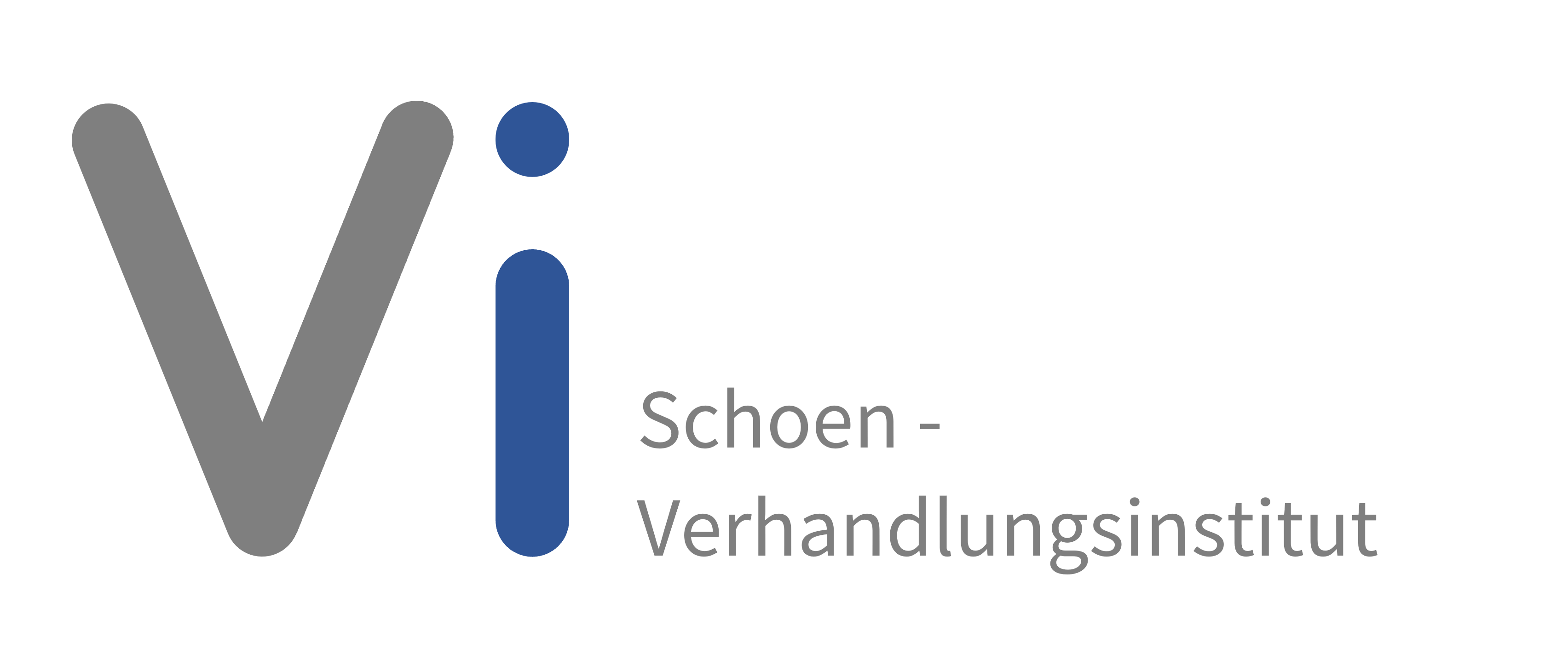Verhandlungen mit Monopolisten – Strategien, Machtbalance und interne Einflussfaktoren im Einkauf
Welche Hebel Sie effektiv haben
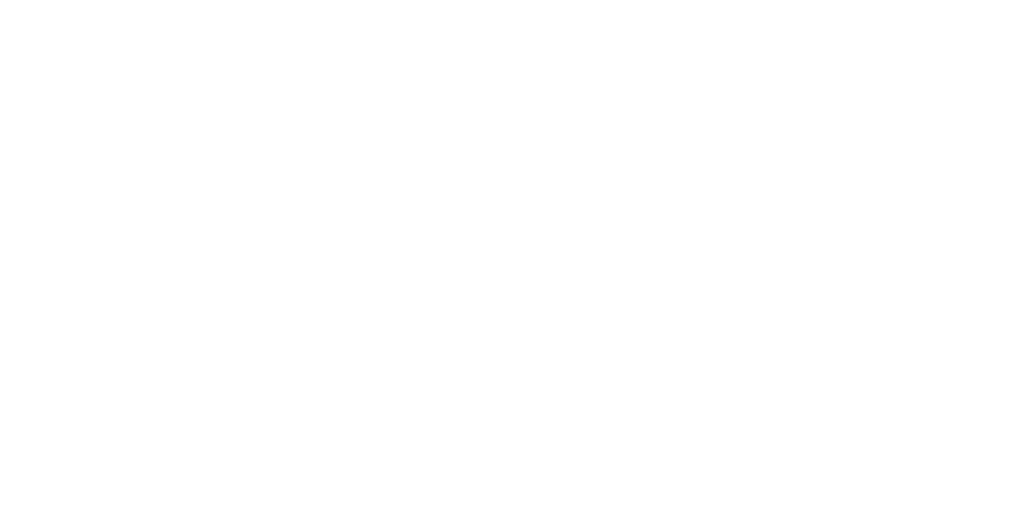


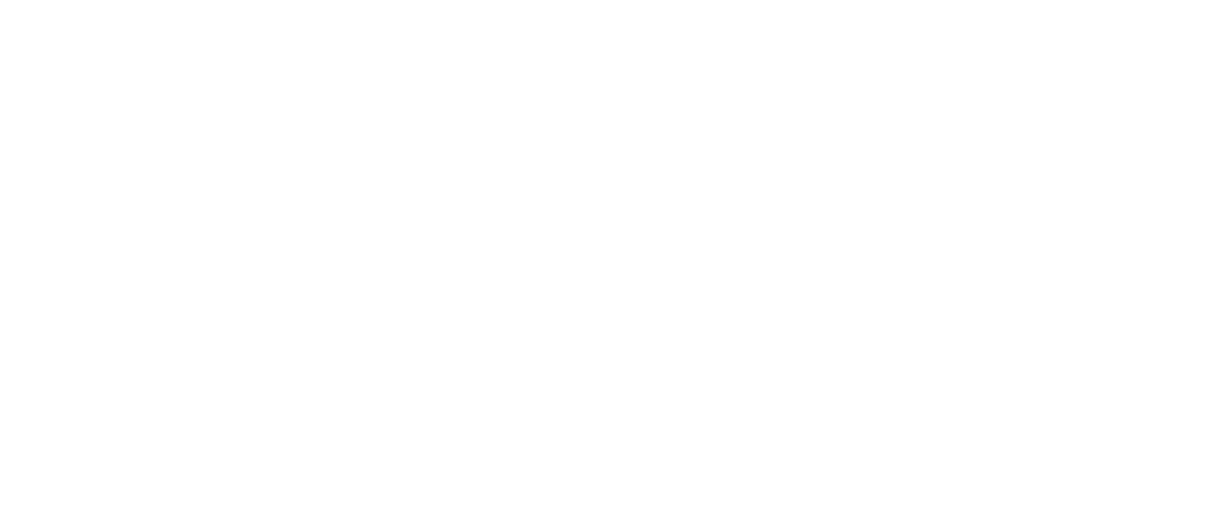


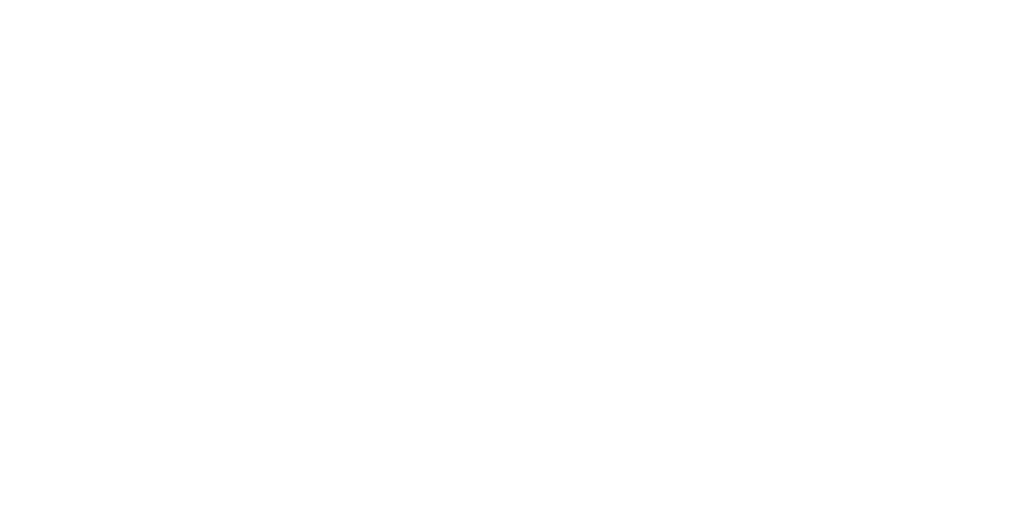

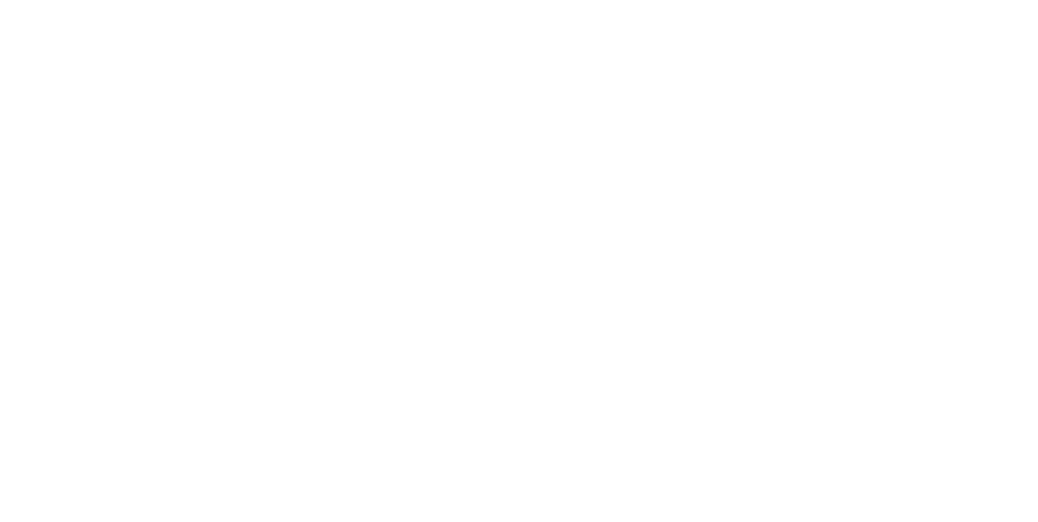
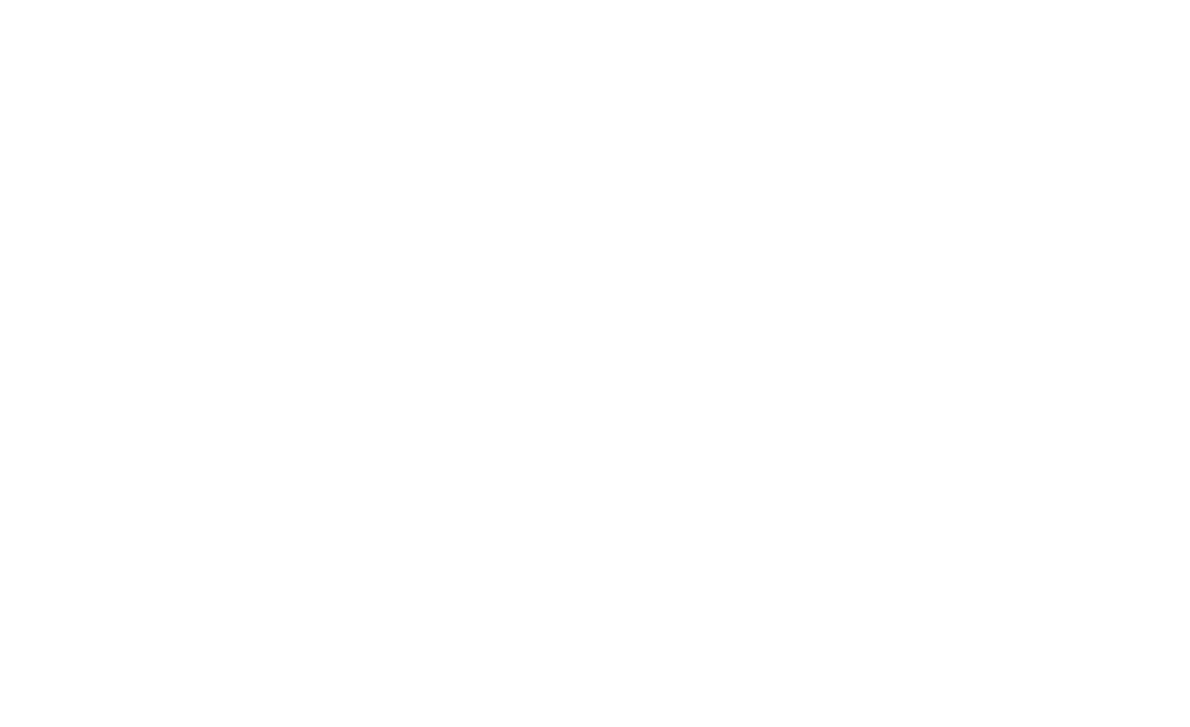
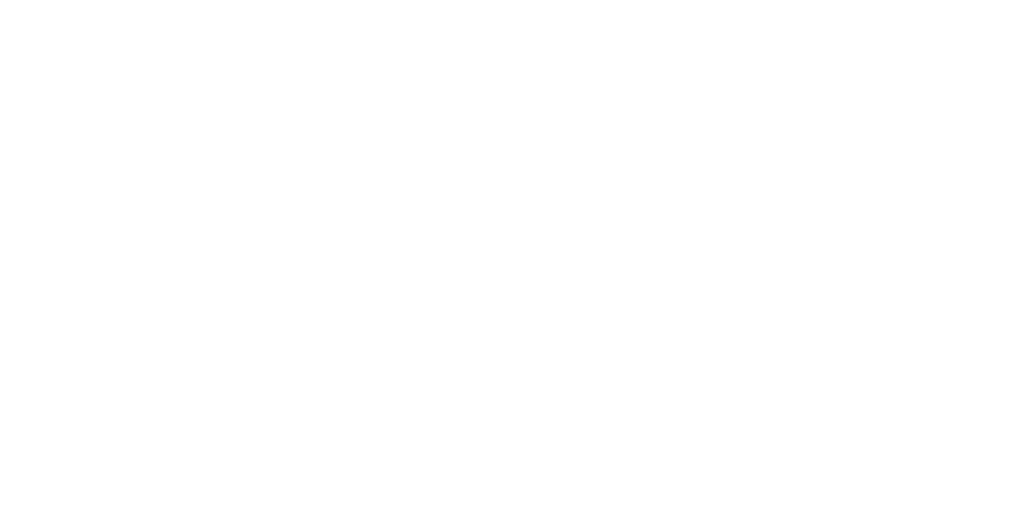
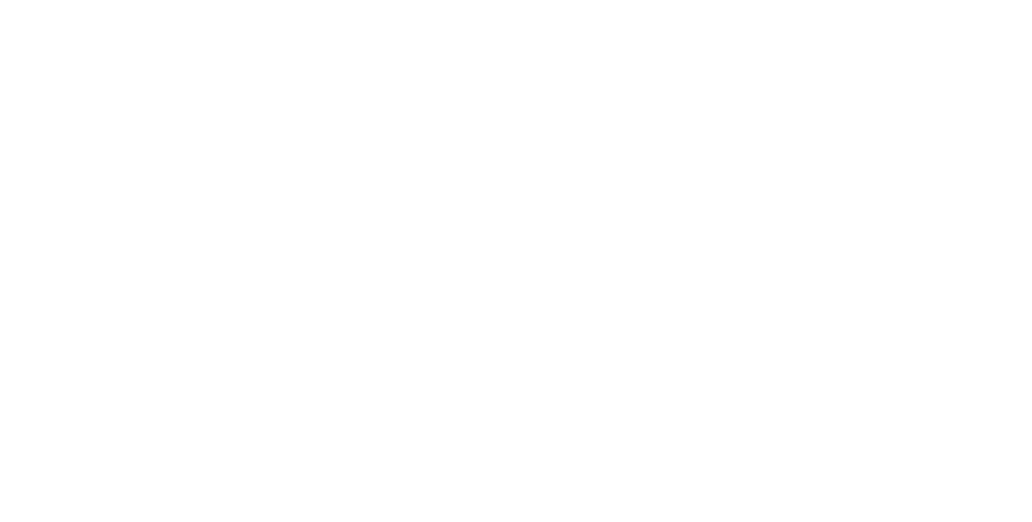
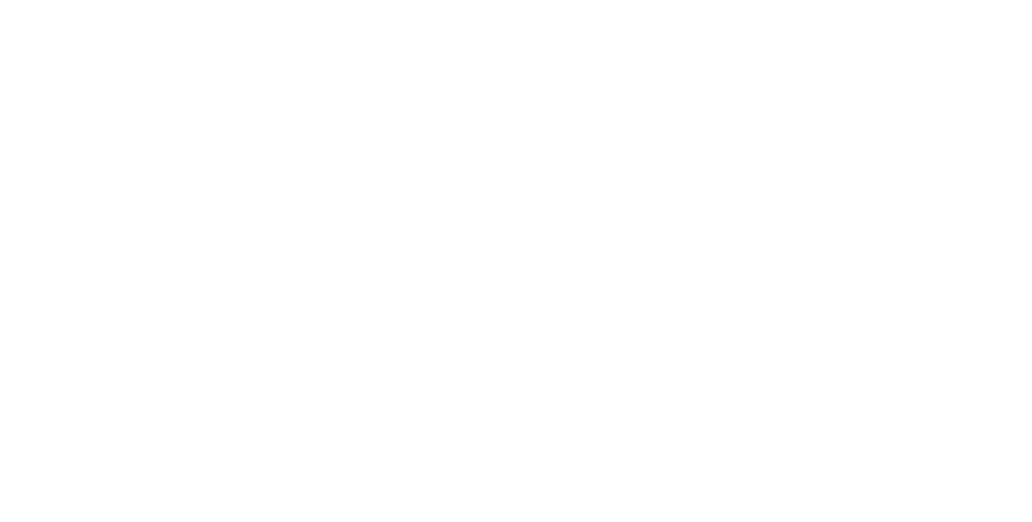

Wenn der Markt kaum Spielraum lässt
Viele Einkaufsleiter fürchten Monopolsituationen – zu Recht. Denn wenn es nur einen Anbieter gibt, scheint jede Verhandlung zum reinen Bestellvorgang zu werden. Doch der Schein trügt: Wer Verhandlungen mit Monopolisten strategisch angeht, erkennt, dass selbst in scheinbar ausweglosen Situationen Spielräume, Einsparpotenziale und Einflussfaktoren bestehen – intern wie extern.

Strategische Verhandlungen mit Monopolisten: Einfluss, Analyse und Change-Management im Einkauf
70 % aller Monopole sind hausgemacht
Nach unserer Erfahrung entstehen rund 70 % aller Monopole nicht auf dem freien Markt, sondern durch interne Entscheidungen. Fachabteilungen legen technische Spezifikationen, Schnittstellen oder exklusive Lieferantenbindungen fest – und schließen dadurch Alternativen unbewusst aus. Hinzu kommt: Die KPI’s dieser Abteilungen messen häufig Output-Qualität, nicht Einkaufseffizienz. Der Einkauf steht am Ende mit nur einem Lieferanten da – und ohne echte Verhandlungsmacht.
Hier setzt professionelles Verhandlungs- und Change-Management im Einkauf an. Denn wer versteht, woher ein Monopol kommt, weiß auch, wie man es auflösen oder zumindest verhandlungsfähig machen kann. Ist es technisch bedingt, strategisch gewollt oder einfach historisch gewachsen? Diese Analyse ist der Schlüssel zur Verhandlungsstrategie.
Change-Management statt Preisverhandlung
Wenn das Monopol im eigenen Unternehmen entstanden ist, wird die Verhandlung zu einer internen Veränderungsinitiative. Jetzt geht es weniger um Zahlungsziele oder Konditionen, sondern um Psychologie, Politik und Kommunikation im Unternehmen. Verhandlungen mit Monopolisten sind dann Verhandlungen über interne Strukturen.
- Wie überzeugt man Fachabteilungen, die „immer schon mit diesem Anbieter“ gearbeitet haben?
- Wie schafft man Bewusstsein für Alternativen, ohne als Störer wahrgenommen zu werden?
- Wie rekonstruiert man Entscheidungsprozesse, um Lieferantenvielfalt wiederherzustellen?
Hier braucht es mehr als Einkaufstaktik – hier braucht es systemisches Verhandlungsdenken. Erfolgreiche Einkäufer werden zu internen Change-Treibern, bauen Allianzen auf und nutzen interne Netzwerke, um Spielräume zu öffnen.
High-Hanging-Fruits: Die restlichen 30 %
Was aber, wenn das Monopol tatsächlich real ist – technologisch, regulatorisch oder marktseitig? Dann beginnt die eigentliche Kunst der Monopol-Verhandlung im Einkauf. Selbst in scheinbar geschlossenen Märkten existieren Spielräume – man muss sie nur erkennen.
In unseren Analysen und Trainings zeigen sich immer wieder dieselben Erfolgsfaktoren:
- Verhandeln über periphere Elemente statt über den Preis: Zahlungsziele, Servicelevel, Reaktionszeiten, Eskalationspfade.
- Einfluss über Sales-Motivatoren und interne Anreizsysteme des Anbieters.
- Analyse von Vertragstexten, Abhängigkeiten und Zeithorizonten – oft liegt dort das größte Potenzial.
- Aufbau von Verhandlungsmacht durch Transparenz: Kostenmodelle, Benchmarkdaten, Szenarien.
Diese High-Hanging-Fruits zu ernten bedeutet, Monopolverhandlungen als strategische Führungsaufgabe zu begreifen – nicht als Preisduell.
Fazit: Wer Monopole versteht, kann sie verhandeln
Ob hausgemacht oder real – Monopole sind kein Verhandlungs-Aus. Sie erfordern lediglich eine andere Herangehensweise: analytischer, politischer, strukturierter. Erfolgreiche Einkäufer kombinieren Cost-Engineering, Machtanalyse und interne Kommunikationsstrategien, um auch dort Einsparungen zu realisieren, wo andere längst kapituliert haben.
Genau dieses Vorgehen trainieren wir praxisnah in unserem Programm Verhandlungstraining Einkauf – dem Format für datenbasierte Verhandlungsführung und souveräne Gespräche mit Monopolisten.